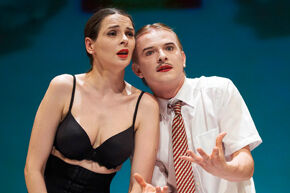Zahnseide, Angelschnur und Rasentrimmer oder: Musizieren macht erfinderisch
Der Stipendiat des aktuellen Caspar-David-Friedrich-Stipendiums, Daniel Blume, ist leidenschaftlicher Musiker. Er spielt mit großem Engagement Kontrabass und Gitarre, und mit eben dieser Leidenschaft forscht er auch. Seine Forschungsziele sind überaus praxisbezogen: Er will sich und anderen das Saitenspiel erleichtern: spieltechnisch, klanglich und auch finanziell.
Dass ein echter Kostenfaktor für Musikerinnen und Musiker die Besaitung der Instrumente darstellt, wissen alle, die es mit der Alten Musik zu tun haben. Im Unterschied zu den Stahlsaiten moderner Instrumente waren die Saiten früher aus organischem Material. – Dass ein Schafsdarm eine Klangschönheit möglich macht, lässt uns immer wieder staunen. – Das Material aber ist fragil: Die Saiten reißen und müssen neu aufgezogen werden. Das geht, gerade bei den tiefen Streichinstrumenten, ins Geld. Während andere diese Situation beklagen, macht sich Daniel Blume daran, selbst tätig zu werden: Er experimentiert mit unterschiedlichen Materialien für Saiten, darunter Zahnseide und Angelschnur. Not macht bekanntlich erfinderisch, auch heute noch. Doch nicht nur die finanziellen Aspekte reizen den so klugen wie humorvollen Musiker. Ich treffe ihn und folge ihm in seine Saitenwerkstatt.
Friederike Wißmann: Lieber Daniel, bevor Sie Stipendiat des CDF-Stipendiums wurden, hörten wir Sie in einem Konzert, in dem Sie schwer bepackt mit verschiedenen Instrumenten auftraten. Es erklang unter anderem ein Kontrabasskonzert auf einem Instrument, das mit schlichter Zahnseide bespannt war. Was hat Sie zum Erfinder gemacht?
Daniel Blume: Da ich auch seit ein paar Jahren die Viola da Gamba (eingedeutscht: Gambe) spiele, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die hohen Saiten aufgrund ihres geringen Durchmessers gepaart mit einer hohen Spannung nach nur wenigen Wochen reißen.
Meine Recherchen brachten mich auf die Veröffentlichung eines zeitgenössischen Gambisten, Rudolf Krönung, der sich seine Saiten mehr oder weniger nach historischem Vorbild selber dreht. Auf der Grundlage der publizierten Messdaten und Ergebnisse stelle ich seither meine eigenen Saiten in Handarbeit her. Ich berufe mich einerseits auf konkrete Anleitungen, beziehe aber auch historische Quellen mit ein, und ich probiere verschiedenste Materialien aus; diese reichen von der Angelschnur, über Klavierdraht, Segelschnur, Bratengarn, Gummiband und Perlseide bis zur Zahnseide. Manchmal kombiniere ich diese auch, um überzeugende Klangbilder zu erschaffen. In der Geschichte der Saiteninstrumente waren die Virtuosen häufig auch für die Weiterentwicklung zuständig. Die strikte Trennung von Wissenschaft und Praxis ist aber ein Produkt des späteren 19. Jahrhunderts.
FW: Tatsächlich ist das Saitenspiel auf Darmsaiten ein anderes: Im Unterschied zu den Stahlsaiten springen diese etwas schwerer an, und, bei aller Klangschönheit, auch die Nebengeräusche, das Kratzen und Knarzen, hat die historisch informierte Aufführungspraxis gerade in den Anfangsjahren in die Kritik gebracht. Was reizt Sie persönlich an den unterschiedlichen Saiten?
DB: Es gibt im Grunde keine zwei gleich gebauten Saiteninstrumente. Ein jedes, dies zumindest bei nicht industriell gefertigten Instrumenten, klingt anders. Schon die verschiedenen natürlichen, aber tatsächlich auch die industriell gefertigten Rohstoffe zeigen nach ihrer Verarbeitung ein ganz besonderes Verhalten. Es ist fast wie ein Fingerabdruck, der sich im Klang bemerkbar macht.
Auf Grundlage vorhandener Studien erschaffe ich eine Art Versuchsanordnung; dabei hat sich gezeigt, dass der richtige Saitenquerschnitt und eine starke Verdrillung den Klang noch zusätzlich optimieren. Hier beziehe ich mich auf ganz unterschiedliche Expertisen aus der Materialforschung – und kombiniere diese. Meine aus Zahnseide hergestellten Saiten unterscheiden sich von denen eines Krönung insofern, als ich den verdrillten Strang nicht doppelt lege. Zudem führt die Nachbehandlung mit (Lein-)Öl zu besserer Bogenansprache und einer optischen Näherung zum tierischen Produkt. Bei den starken Saiten dünne ich die Enden aus. Diese Idee der Saitenausdünnung habe ich von den E-Bass-„Warwick“-Saiten einer besonders tiefen Stimmung übernommen und angepasst.
FW: Sie haben eben – überaus schön – eine Gitarre gespielt, die mit Angelschnur besaitet ist. Mir ist es nicht gelungen, einen klanglichen Unterschied zu den konventionellen Saiten auszumachen. Was unterscheidet die Angelschnur von einer herkömmlichen Gitarrensaite?
DB: Der Trick dahinter ist folgender: Ich habe für die Besaitung teils die käuflich erwerbbaren Carbon-Saiten gewählt und diese mit als Spulenware angelieferter Angelschnur gemischt auf das Instrument gespannt. Im Gegensatz zu den bei der Konzertgitarre üblichen Nylon-Saiten entsteht so ein homogener, klarer, aber immer noch warmer Klang. Auf Grund der höheren Dichte von Carbon (Nylon hat nur etwa zwei Drittel dieser Dichte) werden die Saitenquerschnitte bei gleicher Spannung geringer gehalten – so kann die Saite freier schwingen, was ihre Klangeigenschaften verbessert.
Zunächst war es also eher ein finanzieller Aspekt, der mich zu diesem Experimentierfeld führte. Mittlerweile überwiegt mein Forschungsinteresse. Es geht mir darum, möglichst unideologisch die über Jahrhunderte dokumentierten Experimente zur Saitenherstellung mit unseren modernen Industriematerialien neu zu denken.